
Synonymer Begriff für Springfederdekor.
Frz.: décor guilloché

Für den Auflagendekor verwendete man in Hafnereien und Manufakturen mit Modeln hergestellte Reliefauflagen mit unterschiedlicher Formgebung und Umriss (rund, oval, streifenförmig, Blumen, Zweige, Bilder, Szenen).
Frz.: Motifs d’applique
Engl.: sprigs

Platte, oval mit fassoniertem Rand (Einsiedler-Service), Schweiz, Kanton Zürich, Kilchberg-Schooren, Zürcher Porzellanmanufaktur, 1775-1776, Porzellan, Reliefdekor, Aufglasurmalerei, Vergoldung.
Andreas Heege, 2023
Der Begriff Reliefdekor muss für CERAMICA CH definiert werden, denn eigentlich könnten alle keramischen Oberflächen, die nicht glatt sind, als „reliefiert“ bezeichnet werden, unabhängig davon, wie sie technisch gemacht wurden. Damit wären also auch Auflagendekore mit Reliefauflagen wie z.B. beim Steinzeug oder Eindruckdekore bzw. Stempeldekore als Reliefdekor einzustufen, was aber zu einer wenig spezifischen Terminologie und zu einer unzureichenden Gliederung der Dekore führen würde.
Unter Reliefdekor werden in CERAMICA CH daher nur jene Keramiken eingeordnet, deren Oberfläche entweder beim Giessen in eine Form oder beim Überformen eines Models eine „unebene“, reliefierte Oberfläche erhielten. Einfache Drehstufen oder Grate, wie sie vor allem bei Steinzeug und Steingut vorkommen, werden nicht unter den Reliefdekor aufgenommen, da der Hauptdekor dieser Gefässe meist aus Auflagendekor, Ritzdekor, Stempeldekor oder Pinseldekor besteht. Plastische Griffe, Knäufe oder Henkel werden nicht zum Reliefdekor (und auch nicht zum Auflagendekor) gerechnet.
Französisch: décor en relief
Englisch: moulded decoration in relief

Teller, Italien, Emilia-Romagna, Ferrara ?, um 1480-1500. Engobierte Irdenware («ceramica graffita»).
Beim Ritzdekor handelt es sich um eingetiefte oder Negativ-Dekore, bei denen mit einem spitzen oder spatelförmigen Gerät in unterschiedlichem Umfang durch Ritzen Material aus der noch feuchten oder bereits lederharten Gefässoberfläche entfernt oder verdrängt wird, z. B. ein- oder mehrzeilige Wellenlinien, Fischgrätmuster, konzentrische Linien oder sonstige Muster.

Langnauer Teller mit fassoniertem Rand, Ritzliniendekor als Einfassung anschliessend ausgemalter Flächen.

Heimberger Platte mit Ritzdekor zur Akzentuierung der vorhergehenden Bemalung mit dem Malhörnchen.
Ritzlinien werden auch zur Begrenzung anschliessend farbig ausgemalter Flächen (z.B. bei der Keramik aus Langnau) oder zur Akzentuierung solcher Flächen (z.B. bei Teilen der Keramik „Heimberger Art“) verwendet. Geritzt werden können Oberflächen mit oder ohne Engobe, was nach dem Glasieren und dem Brand zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern führt.
Ritzdekor in weisser Grundengobe und mit grüner oder gelber Glasur wurde in der Schweiz ab dem frühen 16. Jahrhundert angefertigt. Ritzdekor findet sich auch sehr häufig bei italienischer Keramik, die auch nach Frankreich oder zwischen dem 14. und 18. Jh. in die südalpinen Regionen der Schweiz (Tessin, Veltlin) exportiert wurde (z. B. Ceramica ingobbiata graffita arcaica, arcaica tardiva und arcaica evoluta, bzw. graffita a punta e stecca).
Frz.: décor gravé ou incisé, sgraffito sur céramique engobée
Engl.: incised decoration, sgraffito, scratched work

Rollstempel zur Herstellung eines Perldekors (beaded roulette), Hafnerei Kohler, Schüpbach, Kanton Bern
Die Rollstempel (auch «Rouleau», «Redli» oder «Roulette») bestehen oft aus einem Griff und einem auf einer Achse laufenden «Rädchen» aus Holz, Keramik oder Metall mit dem eingeschnittenen Muster. Der Rollstempel erlaubt die Anbringung eines sich wiederholenden Motivs auf dem unglasierten und noch feuchten Ton des Gefässes.
Synonym: Rollrädchen
Frz.: Rouleau à molette
Engl.: Roulettes, coggles, decorating wheels

Muster, die mit Rollstempeln hergestellt wurden, gehören zu den Tonmasse verdrängenden Negativ-Dekoren. Der Dekor heisst Rollstempeldekor.
Frz.: décor à la molette, estampés à la molette
Engl.: rouletted decoration, rouletting
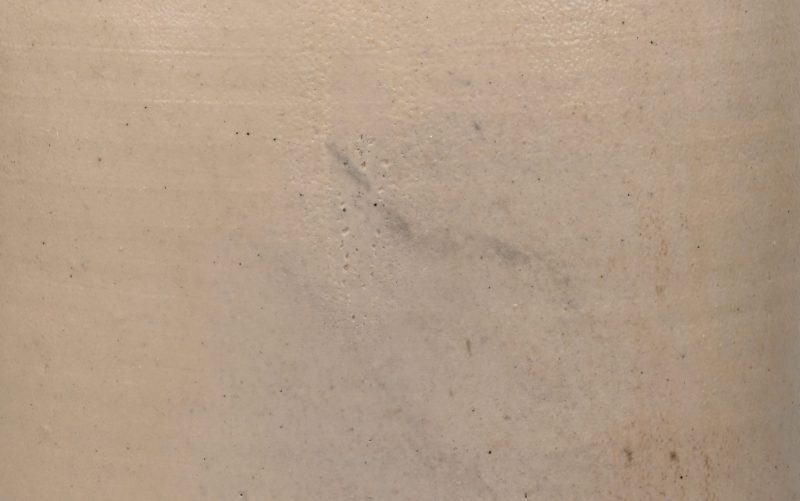
Glasur, die beim Brand von Steinzeug durch in den Ofen eingebrachtes Salz (Natriumchlorid) auf der Gefässoberfläche entsteht. Aufgrund der Hitze des Ofens wird das im Salz (NaCl) enthaltene Chlor abgespalten. Es verbindet sich mit dem Wasserstoff der Luft zu schwefeliger Säure HCl und wird über den Schornstein des Ofens abgeführt. Das Natrium verbindet sich dagegen mit den Silikaten des glühenden Tones und bildet auf der Oberfläche der Gefässe einen glasartigen, chemisch sehr stabilen und säurefesten Überzug.
Frz.: Couverte au sel, glaçure au sel
Engl.: salt-glaze

Schüssel mit Schablonendekor aus der Stadtgrabenfüllung von Bern, Bundesplatz, vor 1579 (Foto Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Andreas Heege).
Andreas Heege und Eva Roth Heege, 2020
Schablonendekor auf Geschirrkeramik wird in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Deutschschweiz entwickelt und ist im archäologischen Fundgut, z.B. in Bern, Zug oder Zürich, nicht sehr häufig (zum Thema: Roth Heege/Thierrin-Michael 2016, 64-66; Frey 2018, 298 und Taf. 1,3). Eine grössere Fundmenge liegt bislang ausschliesslich aus dem Graben von Schloss Hallwil AG vor (Lithberg 1932, Taf. 228-238, 255-257, 278-281; Roth Heege/Thierrin-Michael 2016, Abb. 77; Stephan 1987, 39 Abb. 27).


Schüssel und Dosendeckel, Fehlbrand und Schrühbrand mit Schablonendekor aus der Töpferei Oberaltstadt 3/4 in Zug, zweite Hälfte 16. Jahrhundert (Fotos Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug, Res Eichenberger).
Produktionsnachweise für Geschirrkeramik mit Schablonendekor stammen aus einer Töpferei in der Oberaltstadt 3/4 in Zug (Roth Heege/Thierrin-Michael 2016, Abb. 75 und 76) und einer Töpferei in Schaffhausen, Vordersteig 2 (Bänteli/Bürgin 2017, Abb. 306 und 958).

Dose mit Malhorn- und Ritzdekor aus dem SNM (HA-3001), Thomann 1962, Abb. 20.
An beiden Orten fanden sich, wie auch in Schloss Hallwil (Lithberg 1932, Taf. 255, 281), Deckel zeittypischer Dosen mit Schablonendekor bzw. Fayenceglasur. Dazu besitzt das Schweizerische Nationalmuseum ein 1586 datiertes und mit dem Malhorn verziertes Vergleichsstück (SNM HA-3001; Thomann 1962, Abb. 20). Das Historische Museum in Strassburg hütet das bislang älteste bekannte Vergleichsstück, eine 1568 datierte Dose mit Malhorn- und Schablonendekor (Klein 1989, Taf. 51).




Gewürzdose mit Malhorn- und Schablonendekor, dazu „Zuordnungszahl“ 43 im Inneren und im Deckel. Herkunft wohl aus der Familie Schickler-Pourtalès, Schloss Martinvast bei Cherbourg (versteigert 2019 bei Boscher Enchères, Cherbourg, heute Privatbesitz Schweiz).
Mit diesem Dekor verzierte Dosen oder Objekte sind ansonsten ausgesprochene Raritäten und museal quasi nicht überliefert. Eine grosse Gewürzdose aus einer schweizerischen Privatsammlung stellt die einzige, derzeit bekannte Ausnahme dar.


Fehlbrand und Schrühbrand von Ofenkacheln mit Schablonendekor aus der Töpferei Oberaltstadt 3/4 in Zug, zweite Hälfte 16. Jahrhundert (Fotos Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug, Res Eichenberger).
Der Schablonendekor findet jedoch seit der Mitte des 16. Jahrhunderts grössere Verbreitung auf Ofenkacheln. Produktionsnachweise gibt es auch in diesem Fall aus Zug (Roth Heege/Thierrin-Michael 2016, 64-66). Als früheste absolut datierte Beispiele gelten die Kacheln und Abdeckplatten des Ofensitzes am 1566 datierten Ofen aus der Rosenburg in Stans NW, der sich heute im SNM befindet (Heege 2012, 92-96, Abb. 12).

Bodenfliese der Zeit um 1600 aus dem Winkelriedhaus in Stans NW, Privatbesitz Schweiz.
Ähnlich dekorierte Bodenfliesen finden sich auch unter einem 1577 datierten Kachelofen aus Schloss Altishofen LU und als Fussboden der Zeit um 1600 im Winkelriedhaus in Stans NW (Schnyder 1993).


Schablone und fertige Ofenkachel von Christian Lötscher aus St. Antönien GR, um 1840-1850.
Die Schablonen mit ausgeschnittenen Mustern bestehen meist aus Pergament, Ziegenleder oder Ölpapier (zur Herstellung eine Beschreibung aus dem Jahr 1549: Boltz 1913). Sie werden auf die oft engobierte Gefässwandung oder glatte Kacheloberfläche aufgelegt und dann hellbrennender Ton aufgestrichen, der entsprechend der ausgeschnittenen Löcher ein Muster bildet. Darüber folgt regelhaft eine transparente oder farbige, bei Ofenkacheln meist grüne Glasur. Diese Art der Kacheldekoration war bis in das späte 20. Jahrhundert in der Schweiz, Südwestdeutschland und Vorarlberg beliebt (Schatz 2005; Matter 2007; Leib 2013).
Industrieller Schablonendekor
Abgesehen von diesem handwerklich gefertigten Schablonendekor gibt es aber im 19. und 20. Jh. auch industriell auf Fayence, Steingut und Porzellan angebrachte Schablonenmuster.

Blechschablonen und damit dekorierter Teller aus Varages, Südfrankreich.
Die Schablonentechnik mit dünnen Blechschablonen wurde in der keramischen Industrie bereits im späten 19. Jahrhundert eingesetzt und findet sich bei fast allen europäischen Herstellern. Dabei konnte die Farbe sowohl mit dem Pinsel als auch mit der Spritzpistole aufgetragen werden (zur Schablonentechnik: Gauvin/Becker 2007, 29).
Die Erfindung des Farbauftrags mit Hilfe einer Spritzpistole und Druckluft wurde 1886 in den USA patentiert und im selben Jahr in der Zeitschrift «Der Sprechsaal» in Deutschland vorgestellt. Die Porzellanmanufaktur in Sèvres zeigte bereits 1889 spritzdekorierte Arbeiten auf der Weltausstellung in Paris, andere, auch deutsche Herstellungszentren folgten um die Jahrhundertwende. 1910 besassen 93 deutsche Hersteller eine entsprechende Anlage.




Waschgeschirre mit abstraktem Schablonendekor/Spritzpistolen-Spritzdekor aus den 1920er- und 1930er-Jahren (Klostermuseum Disentis).
Abstrakte Spritzdekorationen mit Schablonen wurden erst zwischen circa 1925 und 1928 entwickelt und waren vor allem in der Zeit der Weimarer Republik im Kontext des Art Deco topmodern (Anthonioz 2019; Figiel 2006).
Synonyme: patronierter Dekor, Patronierung.
Frz.: décor au pochoir
Engl.: stencilled decoration
Bibliographie:
Anthonioz 2019
Stanislas Anthonioz, À la table de l’art moderne. Céramiques de la République de Weimar (1919-1933), Genf 2019.
Bänteli/Bürgin 2017
Kurt Bänteli/Katharina Bürgin, Schaffhausen im Mittelalter – Baugeschichte 1045-1550 und archäologisch-historischer Stadtkataster des baulichen Erbes 1045-1900 (Schaffhauser Archäologie 11), Schaffhausen 2017.
Blondel 2001
Nicole Blondel, Céramique, vocabulaire technique, Paris 2014, 292.
Boltz 1913
Valentin Boltz, Illuminierbuch. Wie man allerlei Farben bereiten, mischen und auftragen soll, allen jungen angehenden Malern und Illuministen nützlich und fürderlich, durch Valentinum Boltz von Ruffach, Nach der ersten Auflage von 1549 herausgegeben, mit Einleitung und Register versehen von Carl. J. Benzinger (Sammlung maltechnischer Schriften 4), München 1913.
Figiel 2006
Joanna Flawia Figiel, Revolution der Muster. Spritzdekor-Keramik um 1930, Ostfildern-Ruit 2006.
Frey 2018
Jonathan Frey, Alles im grünen Bereich. Die Haushaltskeramik vom Bauschänzli in Zürich, datiert vor 1662, in: AS – Archäologie Schweiz/SAM – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit/SBV – Schweizerischer Burgenverein, Die Schweiz von 1350 bis 1850 im Spiegel archäologischer Quellen. Akten des Kolloquiums/Actes du Colloque Bern, 25.–26.1.2018, Basel 2018, 297-308.
Gauvin/Becker 2007
Henri Gauvin/Jean-Jacques Becker, Cent ans de faïences populaires peintes à Sarreguemines et à Digoin, Sarreguemines 2007.
Heege 2012
Andreas Heege, Dekortechniken auf Ofenkeramik, in: Eva Roth Heege, Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel 2012, 68-99.
Klein 1989
Georges Klein, Poteries populaires d’Alsace, Strassburg 1989.
Leib 2013
Sarah Leib, Ausgewählte Aspekte der Kachelofenforschung in Tirol und Vorarlberg, in: Harald Siebenmorgen, Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches Landesmuseum Karlsruhe 24.8.-28.9.2012, Karlsruhe 2013, 191-197.
Lithberg 1932
Nils Lithberg, Schloss Hallwil Bd. 3. Die Funde, Stockholm 1932.
Matter 2007
Annamaria Matter, Dällikon, Mühlestraße 12, Hafnerei Gisler, Kanton Zürich CH, in: Andreas Heege, Töpferöfen-Pottery kilns-Fours de potiers. Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.-20. Jh.) in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz (Basler Hefte zur Archäologie 4), 2007, 321-328.
Roth Heege/Thierrin-Michael 2016
Eva Roth Heege/Gisela Thierrin-Michael, Oberaltstadt 3/4, eine Töpferei des 16. Jahrhunderts und die Geschichte der Häuser, in: Eva Roth Heege, Archäologie der Stadt Zug, Band 2 (Kunstgeschichte und Archäologie im Kanton Zug 8.2), Zug 2016, 10-154.
Schatz 2005
Rolf H. Schatz, Südbadische Ofenkeramik des 16. bis 20. Jahrhunderts mit Berücksichtigung der Nordschweiz und des Oberelsass. Bestandskatalog der Sammlung Rolf H. Schatz. Kacheln aus Museen und Privatbesitz, Kachelöfen, Lörrach 2005.
Schnyder 1993
Rudolf Schnyder, Kachelöfen und Fliesenböden, in: Hansjakob Achermann/Heinz Horat, Das Winkelriedhaus. Geschichte. Restaurierung. Museum, Stans 1993, 135-154.
Stephan 1987
Hans-Georg Stephan, Die bemalte Irdenware der Renaissance in Mitteleuropa (Forschungshefte herausgegeben vom Bayerischen Nationalmuseum 12), München 1987.
Thomann 1962
Hans E. Thomann, Die „Roche“-Apotheken-Fayencen-Sammlung, in: Keramik-Freunde der Schweiz Mitteilungsblatt 58/59, 1962, 11-79.
Zweiter Brand bei der Fayence, bei der der Dekor aus Scharffeuerfarben in die weisse Fayenceglasur eingeschmolzen wird. Der Brand wird auch als Glasurbrand bezeichnet. Dem Scharffeuerbrand geht bei der Fayence immer ein Schrühbrand voraus, an dessen Ende die Gefässe zu Biscuit gebrannt sind.
Frz.: Grand feu
Engl.: Glost firing
Bibliographie:
Blondel 2001
Nicole Blondel, Céramique, vocabulaire technique, Paris 2014, 39, 160, 258.

Vor dem Glasurbrand in den noch ungebrannten Fayenceglasurüberzug gemalter Dekor. Die Farben, die den Glasurbrand, also den zweiten Brand aushalten, sind Kobaltblau, Kupfergrün, Antimongelb und Manganviolett.
Synonym: Inglasurmalerei
Frz.: Peintures de grand feu
Engl.: In-glaze painted decoration
Benachrichtigungen