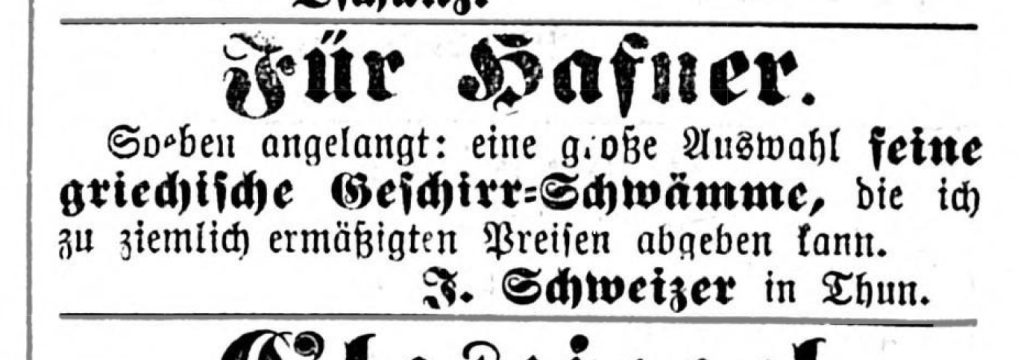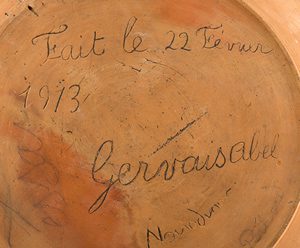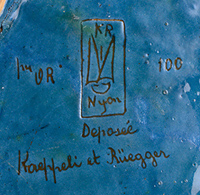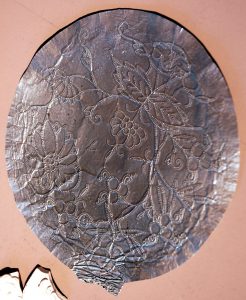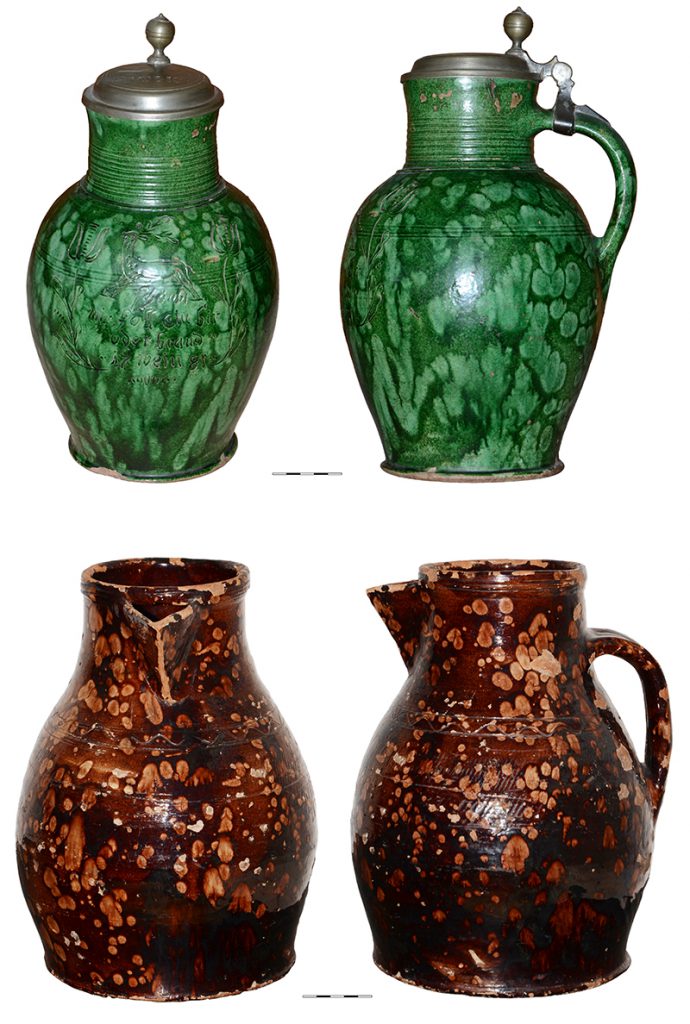Steingut in CERAMICA CH
Steingut wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Staffordshire und Yorkshire (England) auf der Basis salzglasierten, weissen Steinzeugs entwickelt. Ab dem mittleren und späten 18. Jahrhundert produzierte man es auch zunehmend in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Es hat in der Regel einen schwach cremefarbenen bis leicht gelblichen oder fast weissen, sehr feinkörnigen, nicht gesinterten, spezifisch leichten Scherben mit einer gut erkennbaren, abgesetzten Glasurschicht. Diese weist bei archäologischen Fundobjekten relativ häufig ein deutliches Craquelé auf. Keramiktechnologisch handelt es sich um eine bleiglasierte, poröse Irdenware aus weiss brennendem Ton, Kaolin und SiO2 (Quarz, oft gemahlener Feuerstein), eventuell auch nur mit Anteilen von Kalk oder Feldspat oder einer Mischung aller drei Komponenten. In Abhängigkeit von der Zeitstellung und dem Produktionsort gibt es in der Zusammensetzung der keramischen Masse unzählige Variationen. Die keramische Masse des Steinguts lässt sich mit Hilfe von Gipsformen pressen und giessen und eignet sich daher, im Gegensatz zu den Tonen der normalen scheibengedrehten Keramik, zur industriellen Massenproduktion.
Generell werden Steingutobjekte in einem ersten Schrühbrand zu Biscuit gebrannt. Der gemalte, im Umdruckverfahren hergestellte, mit der Schablone aufgetragene oder geschwämmelte Dekor wird aufgebracht und das Stück anschliessend mit einer Bleiglasur überzogen. Ein zweiter Glattbrand wird dann bei einer Termperatur von etwa 1000 ºC durchgeführt. Zusätzlich können in einem dritten Schritt Aufglasurfarben oder Lüster aufgetragen und dann bei einem Muffelbrand (um 800 ºC) fixiert werden.
Aufgrund der Scherbenfarbe und Scherbenstruktur wird Steingut berechtigterweise auch als «weisse Irdenware» – «white earthenware» oder «white-bodied industrial earthenware» – «terres blanches» bezeichnet. Aufgrund ihrer industriell geprägten Fertigung werden alle Varianten des Steinguts auch als «industrielle Keramik» eingeordnet (Bartels 1999, 250-259; Stellingwerf 2019, 42-51). Durch Hinzufügung von Kobalt zur Scherbenmasse entwickelte sich in England aus der gelblichen oder cremefarbenen «creamware» im frühen 19. Jahrhundert die weisse «whiteware».
Ein Zwischenschritt war die Entwicklung von «China glaze» (Staffordshire um 1775) oder «pearl-white» (Josiah Wedgwood um 1779). Dabei wurde eine geringe Menge Kobalt sowohl der Glasur als auch der keramischen Masse hinzugefügt, was das Steingut tendenziell «weisser» und weniger cremefarben erscheinen liess und es dem Porzellan ähnlicher machte. Dieses Steingut bezeichnet man heute zusammenfassend mit einem nicht zeitgenössischen Begriff als «pearlware». Pearlware ist im Gegensatz zur creamware jedoch meistens in irgendeiner Form verziert oder dekoriert oder trägt Umdruckdekore.
Die Steingutmanufakturen, vor allem in England, entwickelten auch weitere farbige meist unglasierte (dry-bodied) Steingutmassen (schwarz, rot, gelb, blau und grün, violett). Ihre technologische Einordnung unter die Gruppenbezeichnung «Steingut» ist nicht unumstritten. Es finden sich in der Literatur auch Zuweisungen zum „Feinsteinzeug“. Im anglo.amerikanischen Sprachraum werden sie auch als «dry-bodied stoneware» bezeichnet (Edwards/Hampson 1998).
Die französische Entwicklung von Steingut oder zeitgenössisch «terre façon anglaise», «terre de pipe», «terre d’Angleterre» bzw. «cailloutage» begann ebenfalls in den frühen 1740er-Jahren. Im zeitgenössischen, französischen Sprachgebrauch lösen sich die Begriffe «terre de pipe» (ca. 1743-1790), «cailloutage» (ca. 1790-1830) und «porcelaine opaque» bzw. «demi-porcelaine» (nach 1830) ab. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Frankreich Keramik mit einem weissen, steingutartigen Scherben «terre de pipe» sowohl eine Fayenceglasur als auch eine einfache Bleiglasur aufweisen kann. Im deutschen Sprachgebrauch würde daraus eine Zuweisung zu «Fayence» bzw. «Steingut» resultieren.
Im 19. Jahrhundert entwickelte die keramische Industrie weitere Varianten des Steinguts, die wesentlich weisser und stossfester waren. Ihre keramische Masse enthielt höhere Anteile an Feldspath und Kaolin. Diese neuen Mischungen erhielten unterschiedliche Bezeichnungen, wie z. B. «Porcelaine opaque», «Granit» oder «ironstone». Sie wurden bei Temperaturen von 1180 et 1300ºC gebrannt. Der Glasurbrand erreichte 1050 et 1080ºC.
Frz.: faïence fine, terre façon anglaise, terre de pipe, terre d’Angleterre, cailloutage, porcelaine opaque, demi porcelaine, céramique industrielle
Engl.: Creamware, pearlware, whiteware, queen’s ware, English industrial ceramics
Übersicht über die Datierung der «industrial wares» (Stellingwerf 2019, Appendix I, mit frdl. Genehmigung des Autors).
Bibliographie:
Barker 2007
David Barker, Creamware in Context, in: Tom Walford/Roger Massey, Creamware and Pearlware Re-examined, Beckenham 2007, 31-42.
Bartels 1999
Michiel Bartels, Steden in Scherven, Zwolle 1999, bes. 250-259.
Blondel 2001
Nicole Blondel, Céramique, vocabulaire technique, Paris 2014, 75.
Edwards/Hampson 1998
Diana Edwards/Rodney Hampson, English dry-bodied stoneware: Wedgwood and contemporary manufacturers 1774 to 1830, Woodbridge Suffolk 1998.
Kybalová 1990
Jana Kybalová, Steingut, Prag 1990.
Maggetti/Rosen/Serneels 2011
Marino Maggetti/Jean Rosen/Vincent Serneels, White earthenware from Lorraine (1755- c. 1820): Provenance and Technique, in: Archaeometry 53, 2011, 765-790.
Maggetti/Heege/Serneels 2015
Marino Maggetti/Andreas Heege/Vincent Serneels, Technological Aspects of early 19th c. English and French white earthenware assemblage from Bern (Switzerland), in: Periodico di Mineralogia, 84, 2015, Heft 1 (Special issue: EMAC 2013, Inside the pottery: composition, technology, sources, provenance and use), 139-168.
Maggetti 2018
Marino Maggetti, Archaeometric Analyses of European 18th-20th Century White Earthenware – A Review, in: Minerals, 2018, Heft 8.
Maire 2008
Christian Maire, Histoire de la faïence fine française 1743-1843, Le Mans 2008, 11-36.
Massey 2007
Roger Massey, Understanding Creamware, in: Tom Walford/Roger Massey, Creamware and Pearlware Re-examined, Beckenham 2007, 15-30.
Roberts 2007
Gaye Blake Roberts, Early Wedgwood Creamware 1759-1769, in: Tom Walford/Roger Massey, Creamware and Pearlware Re-examined, Beckenham 2007, 51-64.
Stellingwerf 2019
Wytze Stellingwerf, The Patriot behind the pot. A historical and archaeological study of ceramics, glassware and politics in the Dutch household of the Revolutionary Era: 1780-1815, Zwolle 2019, bes. 42-51, 202